Antigone
von Sophokles
Deutsch von Simon Werle
mit Texten aus dem Drama »Ich, Antigone« von Anna Gschnitzer
Deutsch von Simon Werle
mit Texten aus dem Drama »Ich, Antigone« von Anna Gschnitzer
Schauspielhaus
Premiere 20. September 2025
ca. 1 Stunde 15 Minuten, keine Pause
Termine
Fr. 13.02.2026
19.30–20.45
Fr. 20.02.2026
19.30–20.45
Ausverkauft
evtl. Restkarten an der Abendkasse
Sa. 28.02.2026
19.30–20.45
TEAM
Regie: Selen Kara
Bühne: Lydia Merkel
Kostüme: Anna Maria Schories
Musik: Torsten Kindermann, Uğur Köse
Dramaturgie: Alexander Leiffheidt
Licht: Marcel Heyde
INHALT
Tochter und Schwester des Ödipus, Tochter und Enkelin der Iokaste, Schwester von Helden und Mördern, letztes Kind eines verfluchten Geschlechts: der Mythos Antigone fasziniert die Menschen seit Jahrtausenden. Ist ihr Beharren darauf, den gefallenen Bruder Polyneikes gegen den zum Gesetz erhobenen Willen des Herrschers Kreon zu begraben, die Tat einer Heldin? Oder die Untat einer Fanatikerin? Antigones unbedingtes moralisches Bewusstsein entlarvt den Pragmatismus der Macht um den Preis des Lebens – nicht nur des eigenen. Ihr Begehren unterwandert eine kalte Ordnung, öffnet darin jedoch die Tür zu Grausamkeit und Zerstörung. Was bedeutet das »ungeschriebene Gesetz«, auf das sie sich bezieht, für uns heute?
Antigone ist ein tausendfach beschriebenes Blatt, zumeist von Männern. Die Regisseurin Selen Kara, deren Arbeit zum ersten Mal in Frankfurt zu sehen ist, befragt den antiken Stoff aus der Perspektive der Frauen. Dabei lenkt sie den Blick auf die Kontinuitäten der Konflikte zwischen Gewissen und Ordnung, Freiheit und Fügung – vom uralten Fluch der Labdakiden bis zu den Menetekeln der Gegenwart.
Antigone ist ein tausendfach beschriebenes Blatt, zumeist von Männern. Die Regisseurin Selen Kara, deren Arbeit zum ersten Mal in Frankfurt zu sehen ist, befragt den antiken Stoff aus der Perspektive der Frauen. Dabei lenkt sie den Blick auf die Kontinuitäten der Konflikte zwischen Gewissen und Ordnung, Freiheit und Fügung – vom uralten Fluch der Labdakiden bis zu den Menetekeln der Gegenwart.

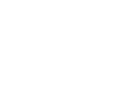
[…]. Die Bühne zeugt in ihrer geometrischen Strenge von Kreons Angst vor anarchischen Zuständen, und sie fügt sich gut ins klare Regiekonzept, das die Figuren zuweilen wie auf dem Spielbrett anordnet. Annie Nowak scheint sich am schwersten mit der auferlegten Regelhaftigkeit zu tun. Sie, die dann am meisten strahlt, wenn sie improvisierend über die Stränge schlagen darf. Genau deswegen ist sie hier womöglich am genau richtigen Platz, als eine, der man die Nötigung der Unterordnung anmerkt. Dabei bekommt jedes Ensemblemitglied gesonderte Momente, um zu glänzen: Katharina Linders Iokaste tut das in schöner stolzer Weisheit, Michael Schütz als herrlich katzbuckelnd und augenrollend lavierender Wächter. Kreon selbst ist bei Arash Nayebbandi in sicheren Händen. Der versteht es, nicht nur den üblichen Tyrannen rauszukehren, sondern spielt den Herrscher in all seiner Brüchigkeit, wiewohl er mitunter das Der-Pate-Register zieht. Viktoria Miknevich wiederum gibt Ismene in vibrierender Zerbrechlichkeit, und Miguel Klein Medina beweint als Haimon seine Braut Antigone mit einem herzerschütternden Monolog, den er vor der ersten Publikumsreihe stehend absolviert. Sie alle verbindet, dass sie nicht nur Figuren darstellen, sondern Menschenqualen. Das mag nicht spektakulär sein, aber es funktioniert, ist stringent und verliert keinen Moment an Spannung. Dazu tragen auch die musikalischen Zeichen bei, die Torsten Kindermann setzt, meist unaufdringliche Atmosphärenverstärker.«